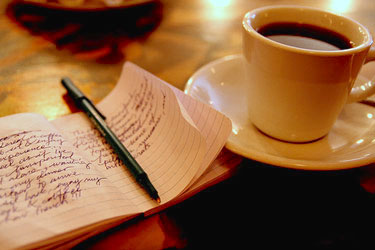Von Enten, Momenten und Monumenten
08/06/25 13:25
Leseprobe aus "Mit meinem Senf dazu"
(Siehe Rubrik "Bücher")Von ganz speziellen Enten ist hier die Rede. Da wäre zunächst der Citroën 2CV, genannt Döschwo, welcher in deutschen Landen aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Spitznamen «Ente» erhielt. Vor dem Zweiten Weltkrieg, im Herbst 1935, hatte Pierre Boulanger, damals Patron von Citroën, eine Vision betreffend eines Autos für die Landbevölkerung, da 48% von Frankreich rurales Gebiet war: «Ein Auto, das zwei Bauern mit Stiefeln, fünfzig Kilo Kartoffeln oder ein Fass mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h transportieren kann und dabei drei Liter Benzin pro Hundert Kilometer verbraucht. Dieses Fahrzeug muss die schlechtesten Strassen befahren können und leicht genug sein, um von einem Fahranfänger problemlos gehandhabt zu werden. Der Komfort muss einwandfrei sein: Die auf der Ladefläche transportierten Eierkörbe müssen unversehrt ankommen. Seine Ästhetik ist mir egal.» Das waren die Vorgaben für das nachmalige Kult-Auto Citroën 2CV.
Bis 1937 wurden neunundvierzig Prototypen zusammengebaut. Ungefähr zweihundert erste Serienexemplare folgten kurz vor dem Krieg. Nur fünf haben überlebt. Die endgültige Silhouette der «Ente» ist 1947 eingefroren.
Am 27. Juli1990 lief der allerletzte Döschwo vom Band. Es war die fünfmillioneneinhundervierzehntausendneunhunderteinundsechzigste «Ente». Meine Beziehung zur Döschwo-Ente ist sozusagen etwas intim, denn anno 1973 fuhr ich währen den langen Semesterferien mit drei Studienkollegen in zwei solchen Fahrzeugen von Luzern nach Kathmandu und zurück. 26'000 Kilometer auf dem damals berühmten Hippie-Trail.
Bei der sogenannten Zeitungsente hingegen handelt es sich um eine Geschichte, die nicht stimmt. Es geht dabei um eine Geschichte oder Nachricht von etwas, das es nicht gibt oder das nicht passiert ist. In früheren Zeiten war es mehr als plausibel anzunehmen, dass der Journalist, der die Zeitungsente verfasst hat, sich irrte.
Neuerdings muss man wohl vermuten, dass jemand etwas Falsches geschrieben hat, obwohl er es besser wusste. Heute spricht man auch kaum mehr von Zeitungsente, denn ausser Zeitungen gibt es mittlerweile auch andere Medien für Nachrichten. Der moderne Begriff lautet „fake news“. Aber woher stammt eigentlich der Begriff «Zeitungsente»? Die klassische Erklärung lautet: Die "Ente" entstand durch die Bezeichnung n.t. (gesprochen "En-te"). Diese steht für (lateinisch) «non testatum» oder (englisch) «not testified» und kennzeichnet Zeitungsartikel, deren Quelle unklar und nicht weiter geprüft ist. Pressegeschichtlich handelt es sich dabei um eine einwandfreie Erklärung. Das Tier Ente wurde jedoch schon mit Falschaussagen in Verbindung gebracht, als es das Massenmedium Zeitung noch gar nicht gab. Martin Luther zum Beispiel benutzte den Begriff "blaue Ente", als er von Irrlehren sprach oder schrieb. Ein Kupferstich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederum zeigt einen "journalistischen Eiertanz", zwischen Wahrheitsfindung und Anpassung an die herrschenden Verhältnisse. Aus dem Beutel des Journalisten gucken zwei Enten heraus. Sie werden als Journal-Enten bezeichnet. Die angelsächsischen Zeitungsleute benutzen die Abkürzung für „not testified“ oder ganz einfach „not true“. Andere vertreten die Ansicht, dass das Wort Zeitungsente aus dem Französischen in den deutschen Sprachgebrauch kam und zwar in Anlehnung an den Ausdruck „donner des canards“ (ein Phrasem für lügen) oder „vendre des canards à moitié“ (wörtlich: Enten zur Hälfte verkaufen, also nicht die ganze Wahrheit sagen).
Ebenfalls eine spezielle Ente ist die Tigerente. Dieses Fabeltier ist eine populäre Figur des deutschen Zeichners und Künstlers Janosch, mit bürgerlichem Namen Horst Eckert. Sie hatte ihren ersten Auftritt in dem Buch «Oh wie schön ist Panama». Die Tigerente ist ein Spielzeug aus Holz, das auf Rädern rollt und an einer Schnur gezogen wird. Sie hat die Form einer Ente, besitzt jedoch ein tigerartiges Streifenmuster. Aber eigentlich ist die Tigerente ursprünglich eine Idee des Künstlers F.K. Waechter, die Janosch, je nach Interview, von diesem „ausgeliehen“ oder auch „gestohlen“ hat. In der Folge kam es auch zu einer Kindersendung im Fernsehen namens «Tigerenten Club». In jeder Folge werden Gäste zu einem Studiothema eingeladen. Des Weiteren gibt es eine Menge Spiele, bei denen Kindermannschaften gegeneinander antreten und zwischendurch laufen spannende Fernsehserien und Reportagen aus fremden und exotischen Ländern.
Auch die WC-Ente kann man getrost zu den exklusiven Entenarten zählen. Die WC-Ente ist ein Toilettenreinigungsprodukt der Schweizerfirma Düring AG. Als wesentliches Charakteristikum hat die Flasche einen gebogenen Hals, mit welchem man die Reinigungsflüssigkeit leichter unter dem Rand der Toilettenschüssel aufbringen kann. Zur Geschichte kann man der Homepage der Firma folgenden Text entnehmen: «Die Form liess der damalige Geschäftsführer der Düring AG, der Drogist Walter Düring, bereits 1980 nach einem Holzprototypen patentieren. Gemeinsam mit seiner Frau Vera brachte er das Produkt anschliessend zur Serienreife. In den folgenden Jahren erzielte die WC-Ente rund um den Globus einen hohen Bekanntheitsgrad. Heute wird knapp Dreiviertel der weltweiten Produktion wird durch Lizenznehmer abgedeckt».
Wie lange dauert ein Moment? Ist ein Augenblick kürzer als ein Moment?
Das Brockhaus Universallexikon setzt Moment mit Augenblick und Zeitpunkt gleich, definiert als sehr kurze Zeitspanne. In Bezug auf den Moment würden wohl die meisten von uns sagen, dass dieser ein paar Minuten vielleicht dauert, auf alle Fälle ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Dabei ist der Moment genau definiert. Es handelt sich nämlich um eine mittelalterliche englische Zeiteinheit, und die ist genau eineinhalb Minuten lang. Als „moment musical“ wiederum wird ein kürzeres instrumentales Charakterstück ohne feste Formbindung bezeichnet, welches meistens für Klavier komponiert wurde. Alle kennen wir gute sowie schlechte Momente und Telefonate erreichen einen stets im falschen Moment. Ich spule hier schon mal ein bisschen vor, damit wir uns nicht allzu arg in die Details verlieren.
In Bezug auf den Augenblick könnte man - rein objektiv betrachtet - die Zeitspanne zwischen zwei Lidschlägen messen und diese dann als Augenblick definieren. Die Antwort auf die Frage: „Wie lange dauert ein Augenblick?“ wäre dann: „Etwa vier bis sechs Sekunden.“ Das ist nämlich die Zeitspanne, in welcher die Augen ununterbrochen geöffnet sind. Danach folgt ein Lidschlag. Dabei wird die Tränenflüssigkeit verteilt, die Augenoberfläche gereinigt und nach ca. 300 bis 400 Millisekunden beginnt mit dem Öffnen des Augenlids ein neuer Augenblick. Viele wünschten sich einen schönen, angenehmen oder emotionalen Augenblick in die Länge zu ziehen oder ihn gar «einzufrieren». So auch der berühmte Doktor Faust. Dieser war ebenfalls bestrebt die äusserst kurze Zeitspannes des Augenblicks auszudehnen. Diesbezüglich legte ihm Goethe folgende Worte in den Mund: „Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!“ Glücklicherweise gibt es auch den günstigen Moment. Die alten Griechen hatten für den günstigen Augenblick - oder wenn Sie lieber wollen für den glücklichen Moment - einen Gott namens Kairos. Darstellungen zeigten Kairos mit einem fast modern wirkenden langen Haarschopf vorne, jedoch mit einem kahlen Hinterkopf sowie Flügeln an den Füssen, die suggerieren sollen, dass der günstige Augenblick eben oft sehr schnell wieder vorbei ist. Sie müssen den günstigen Moment schon beim Schopf packen, wie das bekannte Sprichwort rät, denn sonst greifen Sie ins Leere, respektive dem Gott Kairos an den kahl geschorenen Hinterkopf und verpassen den günstigen Moment.
Um als Monument respektive Denkmal zu gelten, muss das Objekt gemäss einer Definition ohne nähere Quellenangabe von Menschen geschaffen sein und aus vergangener Zeit (aus einer abgeschlossenen, geschichtlichen Epoche) stammen.
Die Larousse-Enzyklopädie ihrerseits definiert Monument als ein architektonisches, skulpturales oder inschriftliches Werk, das die Erinnerung an einen Menschen oder ein bemerkenswertes Ereignis aufrechterhalten soll oder als bemerkenswertes architektonisches Werk aus ästhetischer oder historischer Sicht. Die «Aufarbeitung» - um es ordentlich gelinde zu sagen - der historischen Sicht, vor allem mit dem Akzent der Wokeness, hat ja zum Sturz mehrerer Denkmäler, insbesondere Statuen, gesorgt, ganz nach der Devise: Schon mancher Gockel fiel vom Sockel. Thematisch kann man ein Monument respektive Denkmal in Gedenkstätte, Grabmal, Kenotaph, Ehrenmal, Kriegerdenkmal, Mahnmal, Nationaldenkmal oder Kulturdenkmal gliedern. Auch baulich gesehen findet sich eine breite Palette wie zum Beispiel Mausoleen, Triumphbogen, Siegestore, Ehrenpforten, Statuen, Reiterstandbilder, Stelen, Bildstöcke oder Gebäude. Als Naturdenkmäler gelten gewisse Bäume, Quellen, Wasserfälle, naturbelassene Bachläufe, Bergseen, Fels- und Gletscherbildungen, Höhlen, Mineral- und Fossilvorkommen sowie geologische Aufschlüsse, die wegen ihrer Eigenart oder Seltenheit, ihres landschaftsprägenden Charakters oder ihrer ökologischen, hydrologischen oder geologischen Einmaligkeit im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswürdig sind. Nicht wenige schaffen es auf die Liste des UNESCO-Welterbes. Leider verschwinden Naturdenkmale aus verschiedensten Gründen: Sie müssen einem Neubau weichen, aus Sorge um einen zu grossen Pflegeaufwand etwa für alternde Bäume oder schlichte Unkenntnis der Grundstückseigner um den Denkmalstatus. Gelegentlich ist es allerdings eher Starrsinn. So fiel vor wenigen Jahren in Berlin ein imposanter, geschützter seltener Baum im Vorgarten des Naturkundemuseums nota bene, der neuen Garageneinfahrt des Bundesverkehrsministeriums zum Opfer.
Auch Monumente können unter Denkmalschutz fallen. Letzterer ist in der Regel etwas Kostspieliges und die geschützten Objekte sind vielfach mit (oft inakzeptablen) Auflagen verbunden. Darum lassen vor allem Privatpersonen die Denkmalpflege und denkmalgerechtes Bauen oft bleiben, weil zu teuer, zu übertrieben, zu bürokratisch. Damit werden viele denkmalgeschützte Objekte herrenlos beziehungsweise staatseigen, verkommen oder werden bewusst verwahrlost um nach dem Point-of-no-return, nach Abriss, teures Bauland zu verkaufen. Text ist mitunter ein eminenter Teil eines Monumentes oder Denkmals, denn oftmals bedarf es einer Gedenktafel – insbesondere an „ungegenständlichen“ oder „rein architektonischen» Denkmälern – damit die Assoziation an das bestimmte Gedenken, welches mit dem Denkmal zum Ausdruck gebracht werden soll, allgemein verständlich ist.
Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, aber etliche Denkmäler oder Monumente sind meiner Meinung nach schon entweder potthässlich, geschmacklos oder unproportioniert. Robert Seethaler lässt in diesem Zusammenhang eine Figur in seinem Roman «Das Café ohne Namen» sagen: «Die Füsse der Denkmalfiguren sind immer zu gross. In Wien jedenfalls sind sie immer unförmig und bis zur Lächerlichkeit vergrössert.»
Es ist mir klar, dass meine Ausführungen unvollständig und etwas unbedarft sind. Eigentlich mag ich Kritik gut ertragen. Aber: Kritik kann kritisch sein und durchaus auch mal positiv. Im letzteren Fall sprichts sie Wohlwollen und Anerkennung aus. Man könnte dann fast von Lob sprechen. Und eben: Kritiker sind wie Eunuchen; sie wissen wie es geht, aber sie können es nicht.
Der finnische Komponist Jean Sibelius wiederum meinte zu den Themen Kritiker und Denkmal: «Kümmere dich nicht um das, was die Kritiker sagen. Noch keinem von ihnen ist je ein Denkmal gesetzt worden.»
Ebenfalls eine spezielle Ente ist die Tigerente. Dieses Fabeltier ist eine populäre Figur des deutschen Zeichners und Künstlers Janosch, mit bürgerlichem Namen Horst Eckert. Sie hatte ihren ersten Auftritt in dem Buch «Oh wie schön ist Panama». Die Tigerente ist ein Spielzeug aus Holz, das auf Rädern rollt und an einer Schnur gezogen wird. Sie hat die Form einer Ente, besitzt jedoch ein tigerartiges Streifenmuster. Aber eigentlich ist die Tigerente ursprünglich eine Idee des Künstlers F.K. Waechter, die Janosch, je nach Interview, von diesem „ausgeliehen“ oder auch „gestohlen“ hat. In der Folge kam es auch zu einer Kindersendung im Fernsehen namens «Tigerenten Club». In jeder Folge werden Gäste zu einem Studiothema eingeladen. Des Weiteren gibt es eine Menge Spiele, bei denen Kindermannschaften gegeneinander antreten und zwischendurch laufen spannende Fernsehserien und Reportagen aus fremden und exotischen Ländern.
Auch die WC-Ente kann man getrost zu den exklusiven Entenarten zählen. Die WC-Ente ist ein Toilettenreinigungsprodukt der Schweizerfirma Düring AG. Als wesentliches Charakteristikum hat die Flasche einen gebogenen Hals, mit welchem man die Reinigungsflüssigkeit leichter unter dem Rand der Toilettenschüssel aufbringen kann. Zur Geschichte kann man der Homepage der Firma folgenden Text entnehmen: «Die Form liess der damalige Geschäftsführer der Düring AG, der Drogist Walter Düring, bereits 1980 nach einem Holzprototypen patentieren. Gemeinsam mit seiner Frau Vera brachte er das Produkt anschliessend zur Serienreife. In den folgenden Jahren erzielte die WC-Ente rund um den Globus einen hohen Bekanntheitsgrad. Heute wird knapp Dreiviertel der weltweiten Produktion wird durch Lizenznehmer abgedeckt».
Wie lange dauert ein Moment? Ist ein Augenblick kürzer als ein Moment?
Das Brockhaus Universallexikon setzt Moment mit Augenblick und Zeitpunkt gleich, definiert als sehr kurze Zeitspanne. In Bezug auf den Moment würden wohl die meisten von uns sagen, dass dieser ein paar Minuten vielleicht dauert, auf alle Fälle ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Dabei ist der Moment genau definiert. Es handelt sich nämlich um eine mittelalterliche englische Zeiteinheit, und die ist genau eineinhalb Minuten lang. Als „moment musical“ wiederum wird ein kürzeres instrumentales Charakterstück ohne feste Formbindung bezeichnet, welches meistens für Klavier komponiert wurde. Alle kennen wir gute sowie schlechte Momente und Telefonate erreichen einen stets im falschen Moment. Ich spule hier schon mal ein bisschen vor, damit wir uns nicht allzu arg in die Details verlieren.
In Bezug auf den Augenblick könnte man - rein objektiv betrachtet - die Zeitspanne zwischen zwei Lidschlägen messen und diese dann als Augenblick definieren. Die Antwort auf die Frage: „Wie lange dauert ein Augenblick?“ wäre dann: „Etwa vier bis sechs Sekunden.“ Das ist nämlich die Zeitspanne, in welcher die Augen ununterbrochen geöffnet sind. Danach folgt ein Lidschlag. Dabei wird die Tränenflüssigkeit verteilt, die Augenoberfläche gereinigt und nach ca. 300 bis 400 Millisekunden beginnt mit dem Öffnen des Augenlids ein neuer Augenblick. Viele wünschten sich einen schönen, angenehmen oder emotionalen Augenblick in die Länge zu ziehen oder ihn gar «einzufrieren». So auch der berühmte Doktor Faust. Dieser war ebenfalls bestrebt die äusserst kurze Zeitspannes des Augenblicks auszudehnen. Diesbezüglich legte ihm Goethe folgende Worte in den Mund: „Werd’ ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!“ Glücklicherweise gibt es auch den günstigen Moment. Die alten Griechen hatten für den günstigen Augenblick - oder wenn Sie lieber wollen für den glücklichen Moment - einen Gott namens Kairos. Darstellungen zeigten Kairos mit einem fast modern wirkenden langen Haarschopf vorne, jedoch mit einem kahlen Hinterkopf sowie Flügeln an den Füssen, die suggerieren sollen, dass der günstige Augenblick eben oft sehr schnell wieder vorbei ist. Sie müssen den günstigen Moment schon beim Schopf packen, wie das bekannte Sprichwort rät, denn sonst greifen Sie ins Leere, respektive dem Gott Kairos an den kahl geschorenen Hinterkopf und verpassen den günstigen Moment.
Um als Monument respektive Denkmal zu gelten, muss das Objekt gemäss einer Definition ohne nähere Quellenangabe von Menschen geschaffen sein und aus vergangener Zeit (aus einer abgeschlossenen, geschichtlichen Epoche) stammen.
Die Larousse-Enzyklopädie ihrerseits definiert Monument als ein architektonisches, skulpturales oder inschriftliches Werk, das die Erinnerung an einen Menschen oder ein bemerkenswertes Ereignis aufrechterhalten soll oder als bemerkenswertes architektonisches Werk aus ästhetischer oder historischer Sicht. Die «Aufarbeitung» - um es ordentlich gelinde zu sagen - der historischen Sicht, vor allem mit dem Akzent der Wokeness, hat ja zum Sturz mehrerer Denkmäler, insbesondere Statuen, gesorgt, ganz nach der Devise: Schon mancher Gockel fiel vom Sockel. Thematisch kann man ein Monument respektive Denkmal in Gedenkstätte, Grabmal, Kenotaph, Ehrenmal, Kriegerdenkmal, Mahnmal, Nationaldenkmal oder Kulturdenkmal gliedern. Auch baulich gesehen findet sich eine breite Palette wie zum Beispiel Mausoleen, Triumphbogen, Siegestore, Ehrenpforten, Statuen, Reiterstandbilder, Stelen, Bildstöcke oder Gebäude. Als Naturdenkmäler gelten gewisse Bäume, Quellen, Wasserfälle, naturbelassene Bachläufe, Bergseen, Fels- und Gletscherbildungen, Höhlen, Mineral- und Fossilvorkommen sowie geologische Aufschlüsse, die wegen ihrer Eigenart oder Seltenheit, ihres landschaftsprägenden Charakters oder ihrer ökologischen, hydrologischen oder geologischen Einmaligkeit im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswürdig sind. Nicht wenige schaffen es auf die Liste des UNESCO-Welterbes. Leider verschwinden Naturdenkmale aus verschiedensten Gründen: Sie müssen einem Neubau weichen, aus Sorge um einen zu grossen Pflegeaufwand etwa für alternde Bäume oder schlichte Unkenntnis der Grundstückseigner um den Denkmalstatus. Gelegentlich ist es allerdings eher Starrsinn. So fiel vor wenigen Jahren in Berlin ein imposanter, geschützter seltener Baum im Vorgarten des Naturkundemuseums nota bene, der neuen Garageneinfahrt des Bundesverkehrsministeriums zum Opfer.
Auch Monumente können unter Denkmalschutz fallen. Letzterer ist in der Regel etwas Kostspieliges und die geschützten Objekte sind vielfach mit (oft inakzeptablen) Auflagen verbunden. Darum lassen vor allem Privatpersonen die Denkmalpflege und denkmalgerechtes Bauen oft bleiben, weil zu teuer, zu übertrieben, zu bürokratisch. Damit werden viele denkmalgeschützte Objekte herrenlos beziehungsweise staatseigen, verkommen oder werden bewusst verwahrlost um nach dem Point-of-no-return, nach Abriss, teures Bauland zu verkaufen. Text ist mitunter ein eminenter Teil eines Monumentes oder Denkmals, denn oftmals bedarf es einer Gedenktafel – insbesondere an „ungegenständlichen“ oder „rein architektonischen» Denkmälern – damit die Assoziation an das bestimmte Gedenken, welches mit dem Denkmal zum Ausdruck gebracht werden soll, allgemein verständlich ist.
Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, aber etliche Denkmäler oder Monumente sind meiner Meinung nach schon entweder potthässlich, geschmacklos oder unproportioniert. Robert Seethaler lässt in diesem Zusammenhang eine Figur in seinem Roman «Das Café ohne Namen» sagen: «Die Füsse der Denkmalfiguren sind immer zu gross. In Wien jedenfalls sind sie immer unförmig und bis zur Lächerlichkeit vergrössert.»
Es ist mir klar, dass meine Ausführungen unvollständig und etwas unbedarft sind. Eigentlich mag ich Kritik gut ertragen. Aber: Kritik kann kritisch sein und durchaus auch mal positiv. Im letzteren Fall sprichts sie Wohlwollen und Anerkennung aus. Man könnte dann fast von Lob sprechen. Und eben: Kritiker sind wie Eunuchen; sie wissen wie es geht, aber sie können es nicht.
Der finnische Komponist Jean Sibelius wiederum meinte zu den Themen Kritiker und Denkmal: «Kümmere dich nicht um das, was die Kritiker sagen. Noch keinem von ihnen ist je ein Denkmal gesetzt worden.»