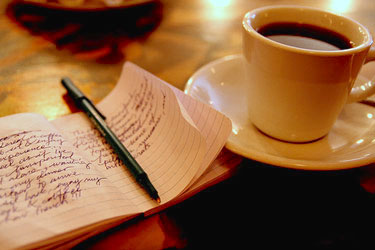Von Elfenbeintürmen, Kartenhäusern, Luftschlössern und anderen ideellen Gebäuden
09/11/25 14:58
Obwohl es die Erbauer ganz anders vorgesehen hatten, so kann ich Ihnen als Sachverständiger für Architekturfragen sagen, dass alle Gebäude der EU in Brüssel Elfenbeintürme sind. Die Bilder, welche man im Internet zu sehen bekommt sind allesamt Fakes. Da sind keine Glaspaläste oder Betonkuben. Das runde Gebäude des EU-Parlamentes - um ein Beispiel zu nennen - hat man mit einer Metall-Glaskonstruktion verschalt um das Elfenbein zu cachieren. Insbesondere Institutionen, aber nicht nur die Universitäten, sondern auch Ämter, Ministerien und Behörden sind Weltmeister darin, ihre Elfenbeintürme zu camouflieren. Das Bundeshaus in Bern, das Kanzleramt in Berlin oder das Elysee in Paris als weitere Beispiele sind allesamt verkappte Elfenbeintürme.
Aber das Elfenbein ist nicht nur ein mysteriöses, geheimnisumwobenes Baumaterial, sondern in den Räumen solcher Gebäude spriesst auch eine ganz spezielle, verwerfliche Mentalität. Es ist ein gerade unsittliches Gebaren, dass die Leute in den Elfenbeintürmen eine stark spezialisierte Fachsprache entwickelt haben, welche von Nichteingeweihten kaum oder gar nicht verstanden wird. Trotzdem wird dieses Geschwurbel dann in der Kommunikation mit der Allgemeinheit angewandt, obwohl oder eben gerade weil man weiss, dass man als Fachmann auf diesem Wege unverstanden bleibt. So erspart man sich Antworten auf unliebsame Erkundigungen. Man hält sich damit einerseits Nachfragen, andererseits aber auch Anschuldigungen vom Leibe. Auch ein überdurchschnittlich gebildeter Bürger kann das betreffende Gebiet (?) über den fachspezifischen Jargon nicht unbedingt verstehen, was als unvermeidliche – mandarf ruhig unterstellen oft auch begrüssenswerte – Tatsache hingenommen wird. Auch die sogenannte Selbstreferenzialität ist eine Elfenbeinturmmentalität, denn es handelt sich dabei eindeutig um den Versuch, Quellen und Verweise als objektive Untermauerung des eigenen Standpunktes zu erwähnen, die aber letzten Endes direkt oder indirekt aus eigener Feder stammen.
Aber das Elfenbein ist nicht nur ein mysteriöses, geheimnisumwobenes Baumaterial, sondern in den Räumen solcher Gebäude spriesst auch eine ganz spezielle, verwerfliche Mentalität. Es ist ein gerade unsittliches Gebaren, dass die Leute in den Elfenbeintürmen eine stark spezialisierte Fachsprache entwickelt haben, welche von Nichteingeweihten kaum oder gar nicht verstanden wird. Trotzdem wird dieses Geschwurbel dann in der Kommunikation mit der Allgemeinheit angewandt, obwohl oder eben gerade weil man weiss, dass man als Fachmann auf diesem Wege unverstanden bleibt. So erspart man sich Antworten auf unliebsame Erkundigungen. Man hält sich damit einerseits Nachfragen, andererseits aber auch Anschuldigungen vom Leibe. Auch ein überdurchschnittlich gebildeter Bürger kann das betreffende Gebiet (?) über den fachspezifischen Jargon nicht unbedingt verstehen, was als unvermeidliche – mandarf ruhig unterstellen oft auch begrüssenswerte – Tatsache hingenommen wird. Auch die sogenannte Selbstreferenzialität ist eine Elfenbeinturmmentalität, denn es handelt sich dabei eindeutig um den Versuch, Quellen und Verweise als objektive Untermauerung des eigenen Standpunktes zu erwähnen, die aber letzten Endes direkt oder indirekt aus eigener Feder stammen.
Wenn von Kartenhäusern die Rede ist, so denkt man eigentlich sofort an ein Geschicklichkeitsspiel respektive einen Zeitvertreib. Es ist mitunter eine Übung der Konzentration und nicht wenige psychologische und motorisch orientierte Tests für Vorschulkinder sehen den Bau eines Kartenhauses vor. Kartenhäuser sind grundsätzlich einsturzgefährdete Gebäulichkeiten. Wenn das Kartenhaus nicht schon bei der Errichtung in sich zusammenfällt, kann man, um den Nervenkitzel noch zu erhöhen, versuchen Karten aus dem Kartenhaus zu entfernen. Wir haben es in diesem Textabschnitt offenbar mit eher instabilen Bauwerken zu tun. Die Redewendung, dass etwas «einstürzt wie ein Kartenhaus» ist denn auch seit dem 19. Jahrhundert belegt.
Das GrazMuseum betitelte vor einigen Jahren seine grosse Herbstausstellung: «Im Kartenhaus der Republik - Graz 1918 bis 1938». Sie thematisierte die Brüche und Kontinuitäten damaliger politischer Grundhaltungen. Die Ausstellung sollte aufzeigen, dass eine instabile Demokratie durch den permanenten Kampf unvereinbarer Kräfte sich als ein „Kartenhaus“ aus hehren Zielen und Werten erweist, das schliesslich in den autoritären Wendejahren in sich zusammenfällt. Die Brisanz dieser Thematik zeigt sich auch aktuell wieder ganz eindrücklich.
Die jüngeren Generationen assoziieren den Begriff Kartenhaus primär mit einer amerikanischen Fernsehserie. Die TV-Serie „House of Cards“ hat die Geschichte von Frank Underwood, einem amoralischen Politiker, und seiner ebenso ehrgeizigen Frau Claire zum Inhalt. Frank wird bei der Ernennung zum Aussenminister übergangen und startet daraufhin mit Claires Unterstützung einen ausgeklügelten Plan, um an die Macht zu gelangen. Die Serie befasst sich mit Themen wie rücksichtslosem Pragmatismus, Manipulation, Verrat und Macht. Da solches Gebaren jedoch in der politischen Realität nie vorkommen soll, handelt es sich offenbar um reine Science Fiction.
Wenig bekannt hingegen ist die Bezeichnung für einen Raum auf grossen Schiffen, in welchem die Seekarten aufbewahrt werden, der gemeinhin Kartenhaus, seltener auch Kartenraum, genannt wird. Wenn Sie ein echtes Kartenhaus besichtigen möchten, so könnten Sie zum Beispiel einen Segeltörn auf der Brigg «Roald Amundsen» buchen. Ein richtiger Event auf einem Segelschiff mit historischer Takelung. Dazu braucht es Neugierde und Lust zum aktiven Segeln sowie die Bereitschaft Teil der Crew des Grossseglers zu werden. Die Brigg ist ein Segelschulungsschiff in der Tradition eines Windjammers. Die Betreiber werben im Internet mit dem Satz: «Ob hoch oben im Rigg des Rahseglers, von Kombüse bis Kabelgatt, von der Mastspitze über das Kartenhaus bis tief unten im Schiffsinneren: Mit der erfahrenen Stammcrew an Ihrer Seite führen Sie alle notwendigen Tätigkeiten – ob im Rigg oder an Deck – gemeinsam durch.»
Historisch befanden sich auf Segelschiffen die Navigationskarten in der im Achterdeck liegenden Kapitänskajüte um die wertvollen Karten dort vor Umwelteinflüssen zu schützen. Nachmalig erfolgte die Integration des Kartenhauses an die Kommandobrücke, sodass es als eigenständiger Raum direkt angrenzte. Später dann wurde der Arbeitsbereich häufiger auf die Brücke selbst gelegt, damit der Wachoffizier auf der Karte arbeiten und trotzdem jederzeit seinen Wachpflichten nachkommen kann.
Beim «Handbuch für Brücke und Kartenhaus» handelt es sich nicht um eine Anleitung wie man ein möglichst hohes Kartenhaus baut, sondern um einen Ratgeber und eine Informationsquelle für die sichere Schiffsführung, herausgegeben vom deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Dies als Ergänzung der Seekarten und Seebücher, wie es im Klappentext heisst. In den technisch orientierten Kapiteln finden sich zudem Informationen über nautische Anlagen, Geräte und Instrumente.
Haben Sie sich auch schon immer gewünscht in einem Schloss zu wohnen, pardon zu residieren? Das dürfte in Zukunft schwierig werden, denn auf dem Immobilienmarkt sind insbesondere die Preise für Luftschlösser durch die Decke gegangen, was vielerlei Gründe hat. Einerseits ist die Nachfrage nach wie vor gross und ungebrochen, weil die Hypotheken für erdbezogene Gebäude nur noch äusserst restriktiv vergeben werden,
andererseits erteilen die zuständigen Bauämter wegen der unzähligen Umweltauflagen in Bezug auf die verpestete Luft kaum mehr Bewilligungen zum Bau neuer Luftschlösser.
Ich hatte ihnen ja vor einiger Zeit schon Hieronimus C. vorgestellt. Während des Immobilien-Booms hatte sich dieser mit dem Bau von Luftschlössern eine goldene Nase verdient. Ein bisschen Hundertwasser, eine Nuance Le Corbusier und ein Quäntchen Norman Foster. Das war die erfolgreiche Mischung für die künftigen Schlossbesitzer.
Aber Hieronymus C. mahnte zu Recht immer wieder an, man solle aufhören ständig neue Luftschlösser zu bauen, man solle lieber zunächst die Finanzierung der Projekte sichern. Schon damals gab es etliche Stimmen die behaupteten die Renovation von Luftschlössern wäre eine viel krisensicherere Sache. Als umtriebiger Geschäftsmann hatte sich auch Hieroymus C. auf die Renovation von Luftschlössern spezialisiert. Alle diejenigen die während des Baubooms an der Substanz für ihre Luftschlösser gespart hatten, kamen nun in Scharen um die notwenigen Reparaturen mindestens planen zu lassen, denn was nützt das schönste Luftschloss, wenn das Dach durchlässig ist, die Mauern zu feuchten beginnen, die Fenster schief hängen und die Heizung streikt, sodass niemand darin wohnen kann. Aber wie gesagt, fliessen die Kredite – selbst für Renovationen - nicht mehr so grosszügig wie einst. Wenn Sie also nicht bereits in einem Luftschloss wohnen, so werden Sie sich wahrscheinlich mit einem Wolkenkuckucksheim begnügen müssen.
Inzwischen auch für Kleinsparer erschwinglich geworden sind hingegen Gedankengebäude und die Banken sprechen für solche Bauvorhaben glücklicher- und intelligenterweise immer noch ordentliche Kredite. Wohin kämen wir denn, wenn die Konstruktion von Gedankengebäuden drastisch limitiert und deren Renovation eingedämmt würde. Aber Hand aufs Herz: Wie viele Leute sind bereit in ein Gedankengebäude zu investieren, wo doch das Denken in der heutigen Zeit nicht mehr gross in Mode ist und zunehmend der künstlichen Intelligenz überlassen wird. Insbesondere logisches Denken ist und bleibt nun mal Schwerstarbeit. Deshalb beschäftigen sich wohl die meisten lieber nicht mehr damit.
Wir werden wohl nicht darum herum kommen, städtebauliche Massnahmen zu ergreifen um architektonischen Auswüchsen und megalomanen Varianten von Gedankengebäuden Einhalt zu gebieten.
Das GrazMuseum betitelte vor einigen Jahren seine grosse Herbstausstellung: «Im Kartenhaus der Republik - Graz 1918 bis 1938». Sie thematisierte die Brüche und Kontinuitäten damaliger politischer Grundhaltungen. Die Ausstellung sollte aufzeigen, dass eine instabile Demokratie durch den permanenten Kampf unvereinbarer Kräfte sich als ein „Kartenhaus“ aus hehren Zielen und Werten erweist, das schliesslich in den autoritären Wendejahren in sich zusammenfällt. Die Brisanz dieser Thematik zeigt sich auch aktuell wieder ganz eindrücklich.
Die jüngeren Generationen assoziieren den Begriff Kartenhaus primär mit einer amerikanischen Fernsehserie. Die TV-Serie „House of Cards“ hat die Geschichte von Frank Underwood, einem amoralischen Politiker, und seiner ebenso ehrgeizigen Frau Claire zum Inhalt. Frank wird bei der Ernennung zum Aussenminister übergangen und startet daraufhin mit Claires Unterstützung einen ausgeklügelten Plan, um an die Macht zu gelangen. Die Serie befasst sich mit Themen wie rücksichtslosem Pragmatismus, Manipulation, Verrat und Macht. Da solches Gebaren jedoch in der politischen Realität nie vorkommen soll, handelt es sich offenbar um reine Science Fiction.
Wenig bekannt hingegen ist die Bezeichnung für einen Raum auf grossen Schiffen, in welchem die Seekarten aufbewahrt werden, der gemeinhin Kartenhaus, seltener auch Kartenraum, genannt wird. Wenn Sie ein echtes Kartenhaus besichtigen möchten, so könnten Sie zum Beispiel einen Segeltörn auf der Brigg «Roald Amundsen» buchen. Ein richtiger Event auf einem Segelschiff mit historischer Takelung. Dazu braucht es Neugierde und Lust zum aktiven Segeln sowie die Bereitschaft Teil der Crew des Grossseglers zu werden. Die Brigg ist ein Segelschulungsschiff in der Tradition eines Windjammers. Die Betreiber werben im Internet mit dem Satz: «Ob hoch oben im Rigg des Rahseglers, von Kombüse bis Kabelgatt, von der Mastspitze über das Kartenhaus bis tief unten im Schiffsinneren: Mit der erfahrenen Stammcrew an Ihrer Seite führen Sie alle notwendigen Tätigkeiten – ob im Rigg oder an Deck – gemeinsam durch.»
Historisch befanden sich auf Segelschiffen die Navigationskarten in der im Achterdeck liegenden Kapitänskajüte um die wertvollen Karten dort vor Umwelteinflüssen zu schützen. Nachmalig erfolgte die Integration des Kartenhauses an die Kommandobrücke, sodass es als eigenständiger Raum direkt angrenzte. Später dann wurde der Arbeitsbereich häufiger auf die Brücke selbst gelegt, damit der Wachoffizier auf der Karte arbeiten und trotzdem jederzeit seinen Wachpflichten nachkommen kann.
Beim «Handbuch für Brücke und Kartenhaus» handelt es sich nicht um eine Anleitung wie man ein möglichst hohes Kartenhaus baut, sondern um einen Ratgeber und eine Informationsquelle für die sichere Schiffsführung, herausgegeben vom deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Dies als Ergänzung der Seekarten und Seebücher, wie es im Klappentext heisst. In den technisch orientierten Kapiteln finden sich zudem Informationen über nautische Anlagen, Geräte und Instrumente.
Haben Sie sich auch schon immer gewünscht in einem Schloss zu wohnen, pardon zu residieren? Das dürfte in Zukunft schwierig werden, denn auf dem Immobilienmarkt sind insbesondere die Preise für Luftschlösser durch die Decke gegangen, was vielerlei Gründe hat. Einerseits ist die Nachfrage nach wie vor gross und ungebrochen, weil die Hypotheken für erdbezogene Gebäude nur noch äusserst restriktiv vergeben werden,
andererseits erteilen die zuständigen Bauämter wegen der unzähligen Umweltauflagen in Bezug auf die verpestete Luft kaum mehr Bewilligungen zum Bau neuer Luftschlösser.
Ich hatte ihnen ja vor einiger Zeit schon Hieronimus C. vorgestellt. Während des Immobilien-Booms hatte sich dieser mit dem Bau von Luftschlössern eine goldene Nase verdient. Ein bisschen Hundertwasser, eine Nuance Le Corbusier und ein Quäntchen Norman Foster. Das war die erfolgreiche Mischung für die künftigen Schlossbesitzer.
Aber Hieronymus C. mahnte zu Recht immer wieder an, man solle aufhören ständig neue Luftschlösser zu bauen, man solle lieber zunächst die Finanzierung der Projekte sichern. Schon damals gab es etliche Stimmen die behaupteten die Renovation von Luftschlössern wäre eine viel krisensicherere Sache. Als umtriebiger Geschäftsmann hatte sich auch Hieroymus C. auf die Renovation von Luftschlössern spezialisiert. Alle diejenigen die während des Baubooms an der Substanz für ihre Luftschlösser gespart hatten, kamen nun in Scharen um die notwenigen Reparaturen mindestens planen zu lassen, denn was nützt das schönste Luftschloss, wenn das Dach durchlässig ist, die Mauern zu feuchten beginnen, die Fenster schief hängen und die Heizung streikt, sodass niemand darin wohnen kann. Aber wie gesagt, fliessen die Kredite – selbst für Renovationen - nicht mehr so grosszügig wie einst. Wenn Sie also nicht bereits in einem Luftschloss wohnen, so werden Sie sich wahrscheinlich mit einem Wolkenkuckucksheim begnügen müssen.
Inzwischen auch für Kleinsparer erschwinglich geworden sind hingegen Gedankengebäude und die Banken sprechen für solche Bauvorhaben glücklicher- und intelligenterweise immer noch ordentliche Kredite. Wohin kämen wir denn, wenn die Konstruktion von Gedankengebäuden drastisch limitiert und deren Renovation eingedämmt würde. Aber Hand aufs Herz: Wie viele Leute sind bereit in ein Gedankengebäude zu investieren, wo doch das Denken in der heutigen Zeit nicht mehr gross in Mode ist und zunehmend der künstlichen Intelligenz überlassen wird. Insbesondere logisches Denken ist und bleibt nun mal Schwerstarbeit. Deshalb beschäftigen sich wohl die meisten lieber nicht mehr damit.
Wir werden wohl nicht darum herum kommen, städtebauliche Massnahmen zu ergreifen um architektonischen Auswüchsen und megalomanen Varianten von Gedankengebäuden Einhalt zu gebieten.